
Wie mich mein tiefster Schmerz dorthin führte, wo meine Heilung begann
Vielleicht kennst Du diesen Punkt, an dem alles in Dir zusammenbricht. Wo Verzweiflung, Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit so übermächtig werden, dass Du keinen Ausweg mehr siehst. Ich war einmal an genau diesem Punkt – im Jahr 2012. Damals bestimmten Dunkelheit, Angst und innere Leere mein Leben, und ich glaubte, dass es keinen anderen Weg mehr gab als den Tod.
Doch das Leben hatte andere Pläne. Es führte mich auf eine Weise weiter, die ich damals als Bedrohung empfand – in eine psychiatrische Klinik. Heute weiß ich: Es war der Beginn meines Heilungsweges. Ich teile meine Geschichte mit Dir, weil ich weiß, dass sich viele Menschen an solchen Wendepunkten verloren fühlen. Vielleicht kann sie Dir Mut machen, Dir Hilfe zu erlauben, wenn Du sie brauchst – und daran zu glauben, dass selbst aus der tiefsten Dunkelheit neues Licht entstehen kann.
Mein seelischer Tiefpunkt – Wenn nichts mehr geht
Im Jahr 2012 fiel ich in ein tiefes seelisches Loch. Ich war vollkommen erschöpft, innerlich leer und fühlte mich furchtbar einsam und verzweifelt. Jeder Tag war eine Qual. Selbst kleinste Dinge lösten Panikattacken aus. Immer häufiger kam mir der Gedanke, mein Leben zu beenden.
Ich begann, mich darauf vorzubereiten – kündigte Abos, löschte Daten, vernichtete persönliche Erinnerungen. Ich glaubte wirklich, dass sich mein Zustand nie wieder ändern würde. Nur der Gedanke an meine Familie und meine geliebten Katzen hielt mich davon ab, diesen letzten Schritt zu gehen. Tief in mir wollte ich nie wirklich sterben – ich wollte nur, dass der Schmerz endlich aufhört.
Widerstand gegen Hilfe – „Mir kann sowieso niemand helfen“
Obwohl es mir so schlecht ging, wollte ich mir damals partout keine Hilfe holen. Jahre zuvor hatte ich schon einige Therapien begonnen – und entweder frustriert oder aufgrund meiner damals sehr starken Hoch- und Tiefgefühle während einer Hochphase unüberlegt wieder abgebrochen. Eine zusätzliche Therapie sah ich deshalb als Zeitverschwendung an. Ich war überzeugt, dass mir ohnehin niemand wirklich helfen konnte.
Vielleicht kennst Du diesen Moment, in dem man spürt, dass es so nicht weitergehen kann – und sich trotzdem nicht traut, Hilfe zuzulassen. Weil man glaubt, man müsste stark sein. Oder weil man sich schämt, so tief gefallen zu sein. Ich glaube, viele Menschen, die lange durchhalten, geraten genau in diesen inneren Konflikt.
Mit einem Aufenthalt in einer Klinik konnte ich mich erst recht nicht anfreunden. Der Gedanke daran machte mir Angst. Was würden meine Arbeitskollegen dann von mir denken? Ich schämte mich für meinen Zustand und wollte nicht, dass jemand etwas merkt. Meine Arbeit war damals der einzige Anker in meinem Leben. Sie gab mir Halt, Struktur und das Gefühl, wenigstens in einem Bereich noch zu „funktionieren“. Mein Tagesablauf war gesichert, und diese Routine hielt mich lange Zeit über Wasser.
Doch die Wochenenden waren die schlimmsten Zeiten. Wenn die äußere Struktur wegfiel, wurde mir schmerzhaft bewusst, wie leer mein Leben eigentlich war – wie haltlos ich innerlich war. Ich spürte, dass ich nur noch funktionierte, aber nicht mehr wirklich lebte.
Heute weiß ich: Mein Widerstand gegen Hilfe war Teil meiner Angst, wirklich hinzusehen.

Der Wendepunkt – Als ich nicht mehr konnte
Die Entscheidung zwischen Aufgeben und Leben
Irgendwann kam der Punkt, an dem ich einfach nicht mehr weitermachen konnte. Ich stand vor einer Entscheidung: entweder aufgeben – oder leben und etwas verändern.
Meine Schwester riet mir, mich an die Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Uniklinik München zu wenden. Dort bekam ich eine erste Diagnose, Empfehlungen für Therapien und eine Liste mit Adressen für psychologische Hilfe.
Zuerst wollte ich wieder eine ambulante Therapie beginnen. Doch es war fast unmöglich, überhaupt jemanden zu erreichen. Jede Absage traf mich wie ein Schlag. Nach jedem Telefonat weinte ich. Ich fühlte mich so hilflos, so verloren.
Ein Arbeitskollege half mir schließlich, die Liste weiter durchzutelefonieren. Und dann hörte ich denselben Satz wieder und wieder: „Bevor wir mit einer ambulanten Therapie beginnen, sollten Sie zuerst einmal in eine Klinik gehen.“ Doch genau dieser Gedanke machte mir schreckliche Angst. Ich wollte das unbedingt vermeiden und klammerte mich an die Vorstellung, es irgendwie anders zu schaffen. Aber irgendwann ging auch das nicht mehr. Und so sah ich keinen anderen Ausweg mehr – und bin, mit viel Unterstützung von einem Bekannten, der den Klinikaufenthalt für mich organisierte, diesen Schritt gegangen.
Der Weg in die Klinik – Vom Dunkel ins Licht
Weihnachten zwischen Zusammenbruch und Hoffnung
Meine Hausärztin stellte mir eine Einweisung aus, und wenige Tage später bekam ich einen Platz in einer psychiatrischen Klinik. Es war kurz vor Weihnachten. Ich wusste, dass ich nach den Feiertagen gehen würde – und genau das machte die Zeit davor so widersprüchlich.
Weihnachten war für mich immer eine Zeit voller Licht, Wärme und Geborgenheit gewesen. Ich hatte diese Tage geliebt, das Zusammensein mit meiner Familie, die Rituale, den Frieden. Doch in diesem Jahr war alles anders. Ich war innerlich zerrissen – zwischen der Sehnsucht nach diesem vertrauten Weihnachtsgefühl und der Dunkelheit, die mich immer stärker in sich hineinzog.
Ich versuchte, irgendwie dabei zu sein, mitzuhalten, so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber in Wahrheit war ich schon nicht mehr wirklich anwesend. Während um mich herum Lichter funkelten, saß ich wie abgeschnitten in meiner eigenen Welt aus Angst, Verzweiflung und Überforderung.
In diesen Tagen wurde ich von emotionalen Ausbrüchen, Höhen und Tiefen regelrecht überrollt. Viele Tränen, Ängste und gleichzeitig diese fast schon verrückten Weihnachtsgefühle wechselten sich ab. Ich war völlig erschöpft von mir selbst – hin- und hergerissen zwischen Zusammenbruch und dem verzweifelten Versuch, mein fröhliches Ich noch irgendwie aufrechtzuerhalten.
Der Schritt, den ich am meisten gefürchtet habe
Am zweiten Weihnachtsfeiertag war es dann so weit. Ich packte meine Tasche und fuhr in die Klinik – nicht mit Erleichterung, sondern mit einem tiefen inneren Widerstand. Ich wollte diesen Schritt eigentlich nicht gehen. Ich war voller Angst, Unsicherheit und Scham.
Ein Bekannter, der selbst Psychologe war, unterstützte mich in dieser Zeit sehr. Er half mir, den Aufenthalt zu organisieren, und gab mir auch einen wichtigen Rat: Ich solle nicht sagen, dass ich akut selbstmordgefährdet sei, denn sonst könnte es passieren, dass ich in eine geschlossene Abteilung komme.
Langsames Ankommen im Unbekannten
Dieser Hinweis hat mir damals tatsächlich geholfen, denn so kam ich in eine offene Abteilung, in der ich mit Erlaubnis der Ärztin die Klinik auch zeitweise verlassen durfte – immer unter der Voraussetzung, dass es mit meinem Zustand vereinbar war.
Trotzdem fiel mir die Anfangszeit unglaublich schwer. Ich konnte mich nur schwer auf die Gespräche und Prozesse einlassen, beantwortete die vielen Fragen eher widerwillig und überlegte oft ganz genau, was ich sagte. Ich war noch weit davon entfernt, mich zu öffnen oder mich wirklich auf Heilung einzulassen.
Erst nach und nach begann ich, innerlich etwas ruhiger zu werden. Dieser Abstand von der Welt – so schmerzhaft er zunächst war – war notwendig, um überhaupt ein Stück weit aus dieser Daueranspannung herauszukommen. Ich war jahrelang im Überlebensmodus gewesen, ständig innerlich auf Alarm. Erst die Distanz zum Alltag gab mir die Möglichkeit, langsam wieder ein wenig zur Ruhe zu finden.
Heute, viele Jahre später, kann ich sagen: Dieser Schritt hat mein Leben gerettet. Denn dort, inmitten all der Unsicherheit, begann ich langsam zu verstehen, dass Heilung nicht darin besteht, stark zu sein, sondern ehrlich. Und dass es manchmal genau die Wege sind, die wir am meisten vermeiden wollen, die uns zurück zu uns selbst führen.

Was ich heute anders machen würde – Heilung beginnt mit dem Blick nach innen
Wenn die Arbeit zur Identität wird
Wenn ich heute auf diese Zeit zurückblicke, erkenne ich, dass ich in meiner ersten Klinikphase noch sehr stark im Außen war. Ich brauchte fast acht Wochen, um überhaupt meine Arbeit aus dem Kopf zu bekommen – ständig hatte ich das Gefühl, dort gebraucht zu werden, und fühlte mich schuldig, nicht „funktionieren“ zu können.
Der versteckte Kern: Existenzangst und Leistungsdruck
Heute weiß ich, dass hinter dieser Abwehr tiefsitzende Existenzängste steckten. Unterbewusst hatte ich solche Angst davor, meinen Platz im Leben zu verlieren, wenn ich nicht mehr arbeite. Damals war meine Arbeit mein einziger Halt – mein letzter Beweis für Daseinsberechtigung und Sinn. Ich glaubte, wenn ich nicht mehr „leistete“, dann würde ich irgendwie nicht mehr existieren. Dieses unbewusste Muster hielt mich davon ab, mir zu erlauben, nicht mehr zu funktionieren – und Hilfe anzunehmen.
Ablenkung durch die Themen anderer
Statt mich auf mich selbst zu konzentrieren, lenkte ich mich mit den Themen der anderen Patienten ab. Ich wollte helfen, Lösungen finden, unterstützen – und übersah dabei, dass das alles nur Ablenkungen waren. Ich war noch nicht bereit, mir selbst zu begegnen.
Energie, Abgrenzung und Heilung inmitten anderer
Erst heute weiß ich, wie wichtig es ist, in einer Klinik den Fokus ganz bewusst auf sich selbst zu richten. Nicht aus Egoismus, sondern weil Heilung nur dann geschehen kann, wenn man sich selbst wieder zuhört.
Manchmal ist es leichter, sich mit den Problemen anderer zu beschäftigen, als die eigene Leere, Angst oder Sehnsucht zu fühlen. Doch genau dort – in dieser Tiefe, die wir so lange vermeiden – wartet das, was wirklich heilen möchte.
Gleichzeitig habe ich im Nachhinein erkannt, dass eine Klinik – so notwendig sie in akuten Phasen auch sein kann – kein einfacher Ort für Heilung ist. Dort treffen viele Menschen aufeinander, die sich alle an ihrem tiefsten Punkt befinden, oft voller Schmerz, Angst und Verzweiflung. Gerade wenn man sehr feinfühlig oder durchlässig ist, kann das enorm herausfordernd sein. Die Energie solcher Orte ist dicht, schwer und aufgeladen.
So wertvoll Gespräche mit Gleichgesinnten sein können – sie bergen auch eine stille Gefahr.
Denn gemeinsames Leiden kann verbinden, aber auch festhalten. Vielleicht hast Du das auch schon erlebt: Dass man sich in Gesprächen über Schmerz und Probleme ein Stück Halt gibt – und doch spürt,
dass es einen gleichzeitig dort festhält, wo man eigentlich hinauswachsen möchte. Man teilt das Dunkel, ohne sich gegenseitig wirklich zu unterstützen, etwas zu verändern.
Darum ist es so wichtig, sich in einer solchen Umgebung immer wieder bewusst abzugrenzen, nach innen zu spüren und bei sich zu bleiben. Nicht alles mitzunehmen, was andere fühlen. Nicht alles zu übernehmen, was im Raum liegt.
Heilung geschieht dort, wo Du Dich selbst wahrnimmst – nicht dort, wo Du versuchst, den Schmerz der anderen mitzutragen.
Wenn Du also selbst einmal in einer Klinik bist oder Dich in einer schwierigen Lebensphase befindest, erlaube Dir, Dich ganz auf Dich selbst einzulassen. Bleib bei Dir. Höre Dir zu. Lass Dich nicht ablenken von dem, was andere erleben. Denn Deine Heilung braucht Dich – ganz und gar –, um geschehen zu können.

Du bist es wert, Hilfe zu bekommen
Mut ist, sich helfen zu lassen
Wenn Du Dich in meiner Geschichte wiederfindest, dann möchte ich Dir eines sagen: Du bist nicht allein. Und vor allem – Du bist es wert, Hilfe zu bekommen. Es ist keine Schwäche, sich einzugestehen, dass man nicht mehr kann. Es ist Mut. Es ist der Moment, in dem Heilung beginnen kann.
Warte nicht, bis es fast zu spät ist. Hilfe gibt es – auch für Dich. Hab keine Angst vor dem Schritt, Dich in eine Klinik einweisen zu lassen, wenn es notwendig ist. Manchmal ist genau dieser Schritt der Beginn Deines neuen Lebens.
Wenn Dunkelheit zu Licht wird
Rückblickend war mein Klinikaufenthalt der erste bewusste Schritt auf meinem Weg zur inneren Heilung. Dort lernte ich, mich auszuruhen, meine Gefühle besser zu verstehen und langsam wieder Vertrauen in mich selbst und in das Leben zu fassen.
Es war kein leichter Schritt, aber er war Teil meines Weges – und er führte mich zu dem Menschen, der ich heute bin. Und zu der Aufgabe, mit meinen Erfahrungen anderen Mut zu machen.
Wenn Du Dich verloren fühlst, erinnere Dich: Gerade in der tiefsten Dunkelheit kann Licht entstehen. Manchmal führt uns das Leben durch die größte Krise, damit wir uns selbst wiederfinden.
Ich hoffe, meine Geschichte erinnert Dich daran, dass es immer heilsame Wege gibt – auch dann, wenn wir ihnen zunächst mit Widerstand begegnen. Manchmal müssen wir das, was uns scheinbar hält, aufgeben, um wirklich neu beginnen zu können.
Nun wünsche ich Dir noch einen wunderschönen Tag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, in welcher Zeit Du Dich gerade befindest.
Die Liebe in mir grüßt die Liebe in Dir.
Deine Andrea 💛
Das könnte Dich auch interessieren
Artikel: Borderline in Beziehungen: Wie ich gelernt habe, mit Panik, Misstrauen und Eifersucht umzugehen
Artikel: Gesunder Umgang mit Emotionen: Ein Leitfaden für inneres Gleichgewicht
Gutes Tun: Yoga als Weg der Selbsterkenntnis - Dein Schlüssel für innere Ruhe, Kraft und spirituellem Wachstum

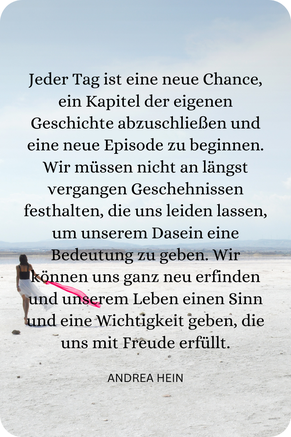


Kommentar schreiben